- Recruiting
- Personalentwicklung
- Mitarbeiterbindung
- Offboarding
- New Work
- Leadership
- Balanced Scorecard
- Change Management
- Demografischer Wandel
- Diversity Management
- Führen auf Distanz
- Führung 4.0
- Führungsmodelle
- Internationales Personalmanagement
- Konfliktmanagement
- Krisenmanagement
- Mitarbeitergespräche
- Personalcontrolling
- Mitarbeiterkommunikation
- Personalplanung
- Personalstrategie
- Zielvereinbarungen
- HR Tools
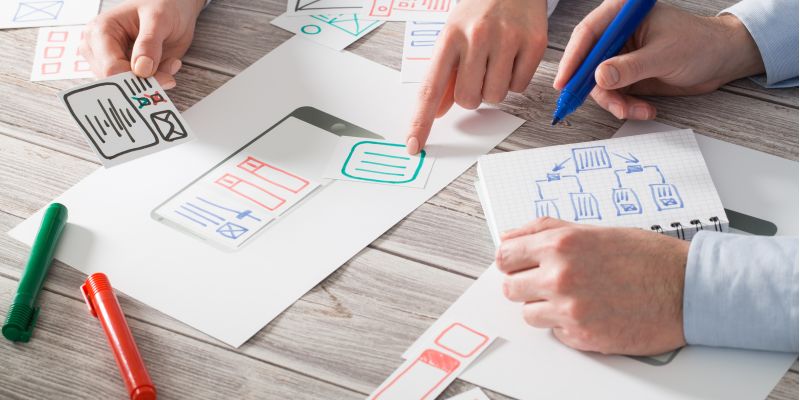 Bildnachweis: stock.adobe.com
Bildnachweis: stock.adobe.com
Mitarbeiterbefragung: Die wichtigsten Begriffe im Mini-Glossar!

Wer Mitarbeiterbefragungen erfolgreich durchführen möchte, stößt schnell auf viele Fachbegriffe. Dieses Glossar erklärt die wichtigsten Konzepte – verständlich und praxisnah.
Mitarbeiterbefragungen sind ein zentrales Instrument, um Stimmung, Engagement und Verbesserungspotenziale im Unternehmen sichtbar zu machen. Doch die Fachsprache ist oft voller Buzzwords. Dieses Glossar erklärt die 20 wichtigsten Begriffe – kategorisiert mit kurzen Praxisbeispielen.

Zur Erinnerung: Das Wichtigste in Kürze zu Mitarbeiterbefragungen!
Mithilfe von Mitarbeiterbefragungen können Sie die tatsächliche Situation in Ihrem Unternehmen zuverlässig spiegeln.
Dabei lassen sich verschiedene Arten von Befragungen voneinander unterscheiden:
- Meinungsumfrage
- Benchmarkinumfrage
- systematische Befragung
- Klimabefragung
- Aufbau- und Einbindungsmanagementprogramm
Regelmäßige Befragungen können das Betriebsklima verbessern, Probleme aufdecken und die Mitarbeitermotivation und -zufriedenheit langfristig erhöhen.
Grundlagen

Employee Engagement beschreibt die emotionale Bindung und Motivation von Mitarbeiter/innen. Ein hohes Engagement führt zu mehr Einsatzbereitschaft, geringerer Fluktuation und einer positiven Unternehmenskultur. Es gilt als einer der zentralen Erfolgsfaktoren für Unternehmen.
Kurzdefinition: Maß für emotionale Bindung und Motivation der Mitarbeiter/innen
Praxisbeispiel: Eine hohe Teilnahme an freiwilligen Projekten zeigt starkes Engagement.

Die Employee Experience umfasst alle Erlebnisse, die Mitarbeiter/innen während ihrer Zeit im Unternehmen machen – von Bewerbungsprozess über die alltägliche Arbeit bis hin zum Austritt. Sie spiegelt wider, wie Mitarbeiter/innen Kultur, Prozesse, Tools und Führung wahrnehmen.
Kurzdefinition: Gesamterlebnis der Mitarbeitenden von Bewerbung bis Austritt.
Praxisbeispiel: Ein flexibler Umgang mit Arbeitszeiten im Unternehmen verbessert die Employee Experience.

Die Mitarbeiterzufriedenheit beschreibt, wie zufrieden Beschäftigte mit ihrer Arbeit, ihrem Umfeld und den Rahmenbedingungen sind. Die Zufriedenheit ist sehr subjektiv und hängt u. a. von Arbeitsbedingungen, Entlohnung, den Kolleginnen und Kollegen und dem Arbeitsklima ab.
Kurzdefinition: Beschreibt, wie zufrieden Beschäftigte mit Arbeit und Umfeld sind.
Praxisbeispiel: Zufriedenheit steigt, wenn Homeoffice-Optionen eingeführt werden.
Fragetypen und Methoden

Closed-Ended Questions sind Fragen mit festen Antwortoptionen (bspw. Multiple Choice). Sie sind leicht auszuwerten und miteinander vergleichbar, liefern aber weniger tiefgehende Einsichten als offene Fragen.
Kurzdefinition: Fragen mit festen Antwortoptionen.
Praxisbeispiel: „Wie oft nehmen Sie an Teammeetings teil?“ → Auswahl: täglich, wöchentlich, selten.

Open-Ended Questions sind offene Fragen ohne vorgegebene Antwortmöglichkeiten, bei denen Mitarbeiter/innen frei formulieren können. Sie bieten wertvolle Einblicke in Meinungen und Erfahrungen, erfordern aber mehr Aufwand bei der Analyse.
Kurzdefinition: (Offene) Fragen ohne Antwortvorgaben.
Praxisbeispiel: „Was sollte im Team verbessert werden?“ → keine Auswahl von Antworten vorgegeben

Die Likert-Skala ist eine häufig genutzte Skala, mit der Zustimmung oder Ablehnung zu einer Aussage gemessen wird (z. B. von „stimme überhaupt nicht zu“ bis „stimme voll zu“). Sie erleichtert die Standardisierung und Auswertung von Antworten.
Kurzdefinition: Bewertungsskala von „stimme nicht zu“ bis „stimme voll zu“.
Praxisbeispiel: „Ich fühle mich von meiner Führungskraft unterstützt.“

Der NPS ist eine Kennzahl, die misst, wie wahrscheinlich Mitarbeiter/innen Ihr Unternehmen weiterempfehlen würden. Die Antwortmöglichkeiten werden auf einer Skala von 0 bis 10 erfasst und in Promotoren, Passive und Kritiker eingeteilt. Ein hoher NPS zeigt eine starke Arbeitgeberattraktivität.
- Promotoren (Wert 9-10): Sehr zufriedende Mitarbeiter/innen, die das Unternehmen aktiv weiterempfehlen würde.
- Passive (Wert 7-8): Zufriedene Mitarbeiter/innen, die allerdings eher neutral eingestellt sind und das Unternehmen nur selten aktiv weiterempfehlen würden. Sie gelten aber nicht als Risiko.
- Kritiker (Wert 0-6): Unzufriedene Mitarbeiter/innen, die das Unternehmen nicht weiterempfehlen würden oder sogar teilweise aktiv von einer Bewerbung abraten.
Kurzdefinition: Kennzahl zur Weiterempfehlungsbereitschaft (0–10 Skala).
Praxisbeispiel: „Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie unser Unternehmen als Arbeitgeber weiterempfehlen?“

Pulsfragen können, mithilfe kurzer, regelmäßiger Umfragen, die aktuelle Stimmung im Unternehmen oder zu einem bestimmten Thema abbilden. Sie sind weniger aufwendig als große Jahresbefragungen und liefern schnelle Einblicke, z. B. zur Zufriedenheit der Belegschaft nach einer organisatorischen Veränderung.
Kurzdefinition: Kurze, regelmäßige Umfrage zur aktuellen Stimmung.
Praxisbeispiel: Nach einer Reorganisation wird monatlich eine Pulsbefragung durchgeführt.
Analyse und Auswertung

Damit Befragungen ehrliches Feedback liefern, ist Anonymität entscheidend. Nur wenn Mitarbeiter/innen sich sicher sein können, dass ihre Antworten nicht auf sie zurückgeführt werden, geben sie unverfälschte Rückmeldungen.
Kurzdefinition: Schutz der Identität der Teilnehmer/innen.
Praxisbeispiel: Die Befragung erfolgt anonymisiert - es besteht keine Pflicht, Namen oder E-Mail-Adressen anzugeben.

Benchmarking beschreibt das Vergleichen von Ergebnissen, bspw. mit früheren Befragungen, zwischen verschiedenen Abteilungen oder mit externen Branchenstandards. Benchmarking hilft, die eigenen Ergebnisse richtig einzuordnen.
Kurzdefinition: Vergleich der aktuellen Ergebnisse mit früheren Ergebnissen oder externen Standards.
Praxisbeispiel: Die Fluktuationsrate wird mit dem Branchendurchschnitt verglichen.

Bias bezeichnet Verzerrungen, die Ergebnisse verfälschen können - bspw. suggestive Fragen, unausgewogene Stichproben oder Selbstselektion („nur die Unzufriedenen antworten“). Bias zu vermeiden, ist zentral für valide Ergebnisse.
Kurzdefinition: Verzerrung von Daten oder Ergebnissen.
Praxisbeispiel: Nur besonders zufriedene Mitarbeiter/innen nehmen teil → Ergebnisse wirken besser, bilden die Realität aber nicht ab.

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) regelt, wie personenbezogene Daten verarbeitet werden dürfen. Bei Mitarbeiterbefragungen betrifft das vor allem sensible Daten in Freitextfeldern oder Rückschlüsse aus kleinen Gruppen. Strenge Einhaltung schafft Vertrauen.
Kurzdefinition: Rechtliche Regeln zum Umgang mit personenbezogenen Daten.
Praxisbeispiel: Freitextfelder werden auf personenbezogene Angaben geprüft und anonymisiert.

People Analytics bezeichnet die systematische Auswertung von HR-Daten (z. B. Befragungen, Fluktuation, Krankenstand), um Muster und Zusammenhänge zu erkennen. Ziel ist dabei, bessere Entscheidungen zu treffen und Probleme frühzeitig zu identifizieren.
Kurzdefinition: Analyse von HR-Daten zur Mustererkennung.
Praxisbeispiel: Hohe Krankentage im Vertrieb werden mit niedriger Zufriedenheit in Befragungen verknüpft.

Die Response Rate beschreibt den Anteil der Mitarbeiter/innen, die an einer Befragung teilnehmen. Eine hohe Teilnahmequote ist wichtig, damit die Ergebnisse repräsentativ und aussagekräftig sind.
Kurzdefinition: Anteil der Teilnehmer/innen an einer Befragung.
Praxisbeispiel: Von 1.000 Eingeladenen antworten 720 → Response Rate: 72 %.

Mithilfe dieser KI-gestützten Methode lassen sich Freitextantworten automatisch nach Stimmungslage klassifizieren. So können Trends und Problemfelder schnell identifiziert werden.
Kurzdefinition: KI erkennt positive, negative oder neutrale Aussagen in Freitexten.
Praxisbeispiel: „Das Onboarding war chaotisch“ → Negativ.

Themen-Clustering meint das automatische Gruppieren ähnlicher Aussagen aus offenen Antworten. So entstehen übergreifende Themenbereiche wie „Kommunikation“, „Führung“ oder „Work-Life-Balance“, die die Analyse vereinfachen.
Kurzdefinition: Automatisches Gruppieren ähnlicher Antworten.
Praxisbeispiel: „Zu viele Meetings“ + „Abstimmungen dauern zu lange“ → Cluster: „Meetings“.
Umsetzung und Maßnahmen

In diesem Prozess werden konkrete Maßnahmen aus den Umfrageergebnissen abgeleitet. Gutes Action Planning stellt sicher, dass Befragungen nicht folgenlos bleiben, sondern tatsächliche Veränderungen anstoßen.
Kurzdefinition: Maßnahmenplanung auf Basis der Ergebnisse.
Praxisbeispiel: Niedrige Werte bei „Work-Life-Balance“ führen zur Einführung flexibler Arbeitszeiten.

Das Follow-Up umfasst die Maßnahmen nach einer Befragung – von der Kommunikation der Ergebnisse bis zur Umsetzung konkreter Verbesserungen. Ohne Follow-Up verlieren Befragungen schnell an Glaubwürdigkeit.
Kurzdefinition: Maßnahmen nach einer Befragung.
Praxisbeispiel: Nach Kritik an Kommunikationprozessen wird ein wöchentliches Teammeeting eingeführt.

Survey Fatigue ("Umfragemüdigkeit") tritt auf, wenn Mitarbeiter/innen zu häufig oder mit schlecht gestalteten Befragungen konfrontiert werden. Die Folge: sinkende Teilnahmequote und oberflächliche Antworten. Daher gilt: Qualität vor Quantität.
Kurzdefinition: Umfragemüdigkeit durch zu viele oder schlecht gestaltete Befragungen.
Praxisbeispiel: Mitarbeiter/innen ignorieren die dritte Umfrage innerhalb eines Monats.

Das 360° Feedback bietet eine umfassende Rückmeldung für Mitarbeiter/innen, die nicht nur von Vorgesetzten, sondern auch von Kolleginnen und Kollegen und manchmal sogar externen Partnern kommt. Sie ergänzt klassische Befragungen um vielfältige Perspektiven.
Kurzdefinition: Feedback von Vorgesetzten, Kolleginnen und Kollegen.
Praxisbeispiel: Eine Abteilungsleiterin erhält Feedback sowohl von ihrem Team als auch von ihrem Vorgesetzten.


